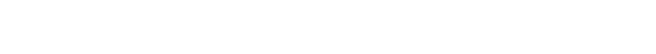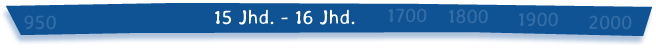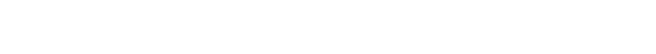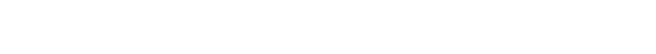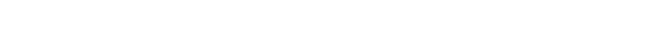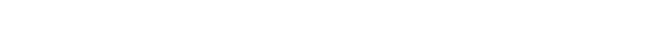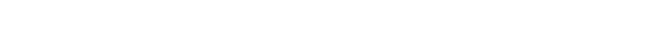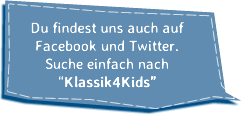Klassik, 1730 – 1830
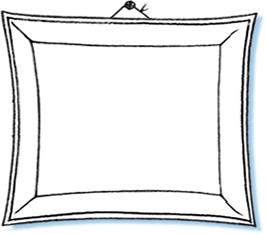

Die Klassik in der Musikgeschichte wird in Frühklassik (ca. 1730 – 1770) und Wiener Klassik (ca. 1770 bis 1830) unterteilt.
Die Frühklassik oder auch Vorklassik löste das Barock ab. Statt der vielen selbständigen Stimmen (Polyphonie) bestimmt eine vordergründige Melodie das Musikstück. Schnörkel und Verzierungen wurden vereinfacht, neue straffe Formen geschaffen. Die Inhalte der Musikstücke waren nicht mehr so oft kirchlich, sondern handelten auch von Dingen, die sich außerhalb der Kirche abspielten. Dies war, weil auch die Bedeutung der Kirche in den Hintergrund rückte.
Sinfonien, Solokonzerte und Streichquartette (zwei Violinen, Bratsche, Violoncello) entstanden als neue musische Gattungen.
Zur Zeit der Klassik waren folgende Instrumente in jedem Orchester zu finden: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Oboe, Flöte, Horn, Trompete und Pauke. Das Orchester bestand aus ungefähr 30 Musikern, die meist fix angestellt und bezahlt wurden.
Vor allem die Sinfonie prägte das Zeitalter der Klassik. Bei ihr spielen alle Orchesterinstrumente gemeinsam, ohne dass eines in einem Solo hervorragt. Joseph Haydn gilt als der Vater der Sinfonie und legte auch die Abfolge der vier Sätze (Allegro zur Eröffnung, langsames Tempo, Menuett – mittelschnell und lebhaftes Finale) fest.
Die Wiener Klassik mit ihren Hauptvertretern Haydn , Mozart und Beethoven wurde von dem Gedankengut der Aufklä rung bestimmt. Das wichtigste Merkmal der Aufklärung war, dass man einsah, dass Menschen Vernunft besaßen und somit ihre Entscheidungen, ob gut oder böse, selber treffen. Der Mensch stand im Mittelpunkt, nicht mehr die Kirche und Gott. Immanuel Kant, ein deutscher Philosoph (Philosoph bedeutet ein Denker, der sich mit dem Studium der Wahrheit beschäftigt und nach Antworten sucht), sagte:
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!".
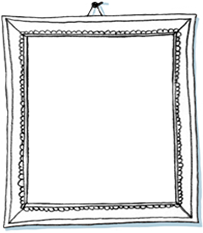

Mit dem "Sturm auf die Bastille", dem Gefängnis, zeigtendie Menschen am 14. Juli 1789, dass sie zusammen stark waren und ihre Forderungen durchsetzen konnten. Die Revolution sollte die Rechte der Bürger stärken, dem Adel seine Macht wegnehmen und den Menschen Mut, Zusammengehörigkeitsgefühl und Eigenständigkeit geben. Die berühmten drei Schlagworte der Revolutionäre waren "Liberté, Égalité et Fraternité", auf deutsch: "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit". Das Ende der französischen Herrschaft war die Hinrichtung Ludwig XVI und seiner Frau Marie-Antoinette, Tochter Maria Theresias.
Künstler verloren einerseits durch die Schwächung des Adels ihre Gönner (Adelige oder Reiche, die sie bei Hofe beschäftigten und bezahlten, auch „Mäzene“ genannt), andererseits konnten sie durch öffentliche Konzerte vor den Menschen in den Städten, die auch anfingen, Kunst zu genießen und durch den Verkauf von Werken selber Geld verdienen.
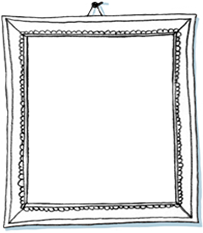

1751 erschien die erste Enzyklopädie, ein Nachschlagewerk, das von Diderot und D'Alembert [Dideroo und d'Alombeer] herausgegeben wurde. Erstmals konnte man zu allen möglichen Begriffen nachschlagen, es kamen auch Menschen aus dem Volk zu Worte, um ihr Wissen ordentlich weiterzugeben.
Eine der bedeutendsten neuen Gattungen der klassischen Musik war die Oper, ein gesungenes Orchesterstück mit Theaterbegleitung, das sowohl fröhlich als auch traurig sein kann. Bei der Oper erlangte die Musik eine immer größere Bedeutung gegenüber der Handlung. Auch setzten sich die nationalen Stile durch, wodurch die Opern in den jeweiligen Landessprachen gesungen wurden. Dadurch verloren sie gewissermaßen an Eleganz, wurden aber für alle Menschen verständlicher. Das berühmteste Beispiel einer „nationalen“ Oper ist die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. 1791, zwei Jahre nach der französischen Revolution, wurde diese Oper in Wien uraufgeführt.
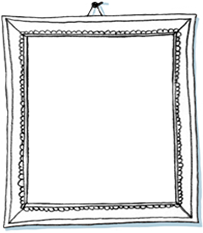

Wien war das neue Zentrum der Musik. Vor allem Mozart und Beethoven, die beide nicht in Wien geboren wurden sondern zum Komponieren dort hin siedelten, zogen viele Musiker in die österreichische Hauptstadt. Auch Josef Haydn ging nach Wien. Zusammen gelten die drei Komponisten Mozart, Beethoven und Haydn als die Hauptvertreter der Wiener Klassik.
Weitere Komponisten der Klassik:
Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Ludwig van Beethoven, Luigi Boccherini, Joseph Bonno, Muzio Clementi, Carl Czerny, Christoph Willibald Gluck, Johann Adolf Hasse, Joseph Haydn, Jean-Marie Leclair, Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Joachim Quantz, Antonio Salieri, Giovanni Battista Sammartini, Joseph Starzer, Giuseppe Tartini, Georg Christoph Wagenseil